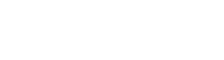Women in Jazz – Frauen erobern eine Männerdomäne
Der Jazz hat ein neues Gesicht. Wie schon so oft in der etwa einhundert jährigen Geschichte hat sich das Erscheinungsbild des Jazz gewandelt: Es ist emotional, betörend erotisch,
und es ist weiblich.
Seit Mitte der 1990er Jahre ist zu beobachten, dass die Zahl der Musikerinnen im Jazz stetig ansteigt. Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der unerwartete kommerzielle Erfolg der amerikanischen Sängerinnen Diana Krall und Norah Jones. In deren Gefolge betraten unzählige Sängerinnen Bühnen und Studios und kreierten eine neue Welle des weiblichen Jazz-Gesangs. Auch im instrumentalen Bereich, wenn auch mit geringerer kommerzieller Beachtung, erarbeiteten sich selbstbewusste Frauen entspannt und ohne vordergründigen feministischen Hintergrund Führungspositionen in Bands und musikalischen Ensembles.
Als ein wichtiges Zentrum dieser Entwicklung hat sich das Festival „Women in Jazz“ in Halle etabliert. Bereits zum vierten Mal trafen im Februar 2009 jazzende Frauen auf ein interessiertes Publikum. Dabei standen die Kritiker dem Konzept von Organisator Ulf Herden zu Beginn eher skeptisch gegenüber. Es gab Bedenken, ob genügend innovative musikalische Projekte existieren, um die Idee über mehrere Jahre zu realisieren. Außerdem traten Jazz- Puristen auf den Plan, die unterstellten, dass ein Teil der musikalischen Acts nicht dem Jazz zuzuordnen sei. Das wachsende Interesse von Künstlerinnen und Publikum aber auch die mittlerweile überregionale Aufmerksamkeit der Kritiker zeugen jedoch vom Erfolg des eingeschlagenen Wegs.
Was sind das für Frauen, die das neue Erscheinungsbild des Jazz prägen?
Im Rahmen des Festivals „Women in Jazz“ wurden Musikerinnen interviewt. Die Befragungen ergaben ein sehr vielschichtiges Bild.1 Die Jazz-Frauen sind durchweg sehr gut ausgebildet, wobei die Bandbreite von der Autodidaktin bis zur Hochschulabsolventin reicht. Die Liebe zum Jazz bildet sich, oft auch auf Umwegen, meist in der Pubertät heraus. In einem langen und intensiven Prozess wachsen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten von Musikerinnen heran. Die Organistin Barbara Dennerlein entwickelte bei der Umsetzung ihrer künstlerischen Ideen aber auch in der Organisation ihres musikalischen Berufsalltags geradezu „männliche Eigenschaften“, was bei Mitspielern nicht immer auf Gegenliebe stieß. Die Musikerin sagte dazu: „Wenn ein Mann weiß, was er will und sich dafür mit seiner Energie einsetzt, dann wird er bewundert. Wenn das gleiche eine Frau macht, dann ruft das zwiespältige Gefühle hervor. Schnell heißt es ‚Die ist arrogant’ oder ‚Ist das eine Zicke’“2 Andere Musikerinnen leben gerade die Rolle als Frau bewusst aus.
Maria Joao setzt neben ihrer exzellenten und wandlungsfähigen Stimme auch auf optische Reize und präsentiert sich als selbstbewusste Jazzdiva. Gleichzeitig entwickelt sie im Umgang mit ihren Musikern eine hohe emotionale Kompetenz und entfaltet auf der Bühne eine geradezu familiäre Atmosphäre, die sich auch auf den Zuschauerraum überträgt.
Sie sagt von sich: „I’am a happy woman“3, und das spürt man in jedem Moment ihres Auftritts. Alle interviewten Frauen haben im Jazz ein Wirkungsfeld gefunden, in dem sie sich musikalisch ausleben können. Dotschy Reinhardt, Sängerin mit Wurzeln im Gipsy-Jazz, meint dazu: „Ich liebe den Jazz dafür, dass er mir so viele Möglichkeiten bietet, frei zu
agieren. Wenn es um Freiheit in der Musik geht, dann ist Jazz sicherlich der Ort, an dem man die meisten Freiheiten genießt.“4
Gleichzeitig finden die Frauen zunehmend im Jazz eine berufliche Perspektive, die über die Zeit der rein optischen Attraktivität und des schnellen Erfolg hinausreicht.
Uschi Brüning: „Das ist einfach eine Musik, die immer leben wird und mit der man auch immer noch leben kann, wenn man älter ist. Musik, die immer eine Entwicklung bereit hält. Da gibt es kein Ende, kein Ankommen und das hat mich daran gereizt und reizt mich bis heute.“5
Welche Akzente setzen die Frauen in musikalischer Hinsicht?
Auch wenn die Musikerinnen nicht vordergründig als Frauen von ihren männlichen Kollegen wahrgenommen werden, weil für sie allein das Musikalische wichtig ist, ändert sich in den Bands das psychosoziale Klima. Nils Landgren, der in vielen seiner Projekte mit Frauen musiziert, konstatiert in den gemischten Besetzungen das „Aufbrechen der Musikermentalität.“6
Viele Musiker des Jazz pflegen auch heute noch das selbstbewusste, manchmal fast aggressive, Auftreten aus der Zeit des Bebop und den nachfolgenden Spielarten, in denen vor allem der instrumentale Wettstreit im Mittelpunkt steht. Die Solisten treten mit ihren instrumentalen Soli gegeneinander an und werben um die Gunst des Publikums. Es ist ein Kampf Mann gegen Mann, bei dem die Kollegen auch schon mal die Bühne verlassen, wenn der Konkurrent seinen Part spielt. Diese solistischen Einlagen haben an Bedeutung verloren. Im Mittelpunkt der aktuellen, von Frauen komponierten und interpretierten Musik steht der Song. Dieser stellt nicht nur melodisches und harmonisches Material zum Improvisieren bereit, sondern bietet den Musikerinnen die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und emotionale Stimmungen aufzubauen. Diese werden von den anderen Mitmusikern gleichberechtigt begleitet, dann aber auch solistisch weitergesponnen. Die Stücke verlieren ihren schematischen Ablauf und die Soli werden zu punktuellen instrumentalen Höhepunkten. Gleichberechtigt entwickeln die Musikerinnen und Musiker ihr Repertoire. Simin Tander fungiert zwar als Bandleaderin aber beschreibt die musikalische Arbeit als gemeinsames Miteinander. „Rein musikalisch finde ich mich selber nicht wichtiger, als die anderen. Wir sind gleich wenn wir spielen.“7
Die Musik klingt insgesamt harmonischer und korrespondiert mit der Swing-Ära der 1930er Jahre. Damals komponierten die Größen des zeitgenössischen Jazz eine Vielzahl fast schlagerartiger Songs, die umfangreiches musikalisches Material für die nachfolgenden Stile bot und bis heute Standarts in Realbook-Ausgaben bereitstellt. Die Entwicklung im Jazz weist deutliche Parallelen zur zeitgenössischen E-Musik auf. Auch hier besinnen sich die Komponisten, nach zwischenzeitlichen Ausflügen in freie Bereiche und das Ausreizen aller klanglichen und technischen Möglichkeiten, auf harmonische Strukturen und melodische Einfachheit.
Der Jazz bietet in seiner stilistischen Breite Raum für diese Entwicklungen, auch wenn einige Kritiker das Verlassen der Jazz-Nische und den damit verbundenen größeren kommerziellen Erfolg mit Argwohn zur Kenntnis nehmen.
Der Jazz entwickelt sich weiter und wir dürfen auf die neuen Projekte mit Musikerinnen gespannt sein.
„Die Zeit ist reif, die reinen Männerklubs im Jazz zu beenden.“8 (Nils Landgren)